Von Felizitas Küble
Das Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“ ist ein häufiges Kennzeichen irrgeistiger „Offenbarungen“. In den entsprechenden Botschaften werden die Seher (meist sind des freilich Seherinnen) von himmlischen Gestalten – oft Jesus oder Maria – über den grünen Klee gelobt, ihre Vorzüglichkeit gepriesen, ihre besondere Sendung und Einzigartikeit verkündet und vielfach bedankt sich die Erscheinung auch bei den „Begnaden“ für ihren eifrigen Einsatz bei der Verbreitung der angeblichen Aufrufe „von oben“.
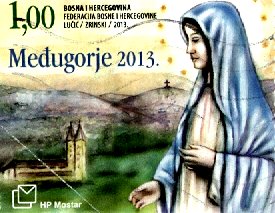
Auch in Medjugorje bedankt sich die „Madonna“ ständig bei den Visionären, daß sie „ihrem Ruf gefolgt“ seien etc.
Dieses (un)geistliche Zuckerbrot ist nichts Neues in der Kirchengeschichte. Die hl. Teresa von Avila, die selber als große Mystikerin gilt, warnte vor dieser religiösen Sentimentalität:
„Schwer täuschen sich jene, die meinen, die Vereinigung mit Gott bestehe in Ekstasen, Verzückungen und geistlichen Tröstungen. Sie besteht allein in der vollkommenen Übergabe unseres Willens an Gott.“
Das zweite typische Kennzeichen der Pseudo-Mystik ist die „Peitsche“ – natürlich an jene gerichtet, welche die „Botschaften“ nicht annehmen. Ob Sievernich oder Eisenberg (Rasenkreuz), ob Amsterdam oder Garabandal, ob Medjugorje oder die Visionen der Antonie Rädler von Wigratzbad: Stets gibt es eine „Rachemadonna“, die den Skeptikern den Marsch bläst, auch wenn es sich dabei um die kirchliche Obrigkeit handelt, die ja bekanntermaßen mit derartigen Phänomenen sehr vorsichtig ist – immerhin beruht diese Haltung aus einer Erfahrung von 2000 Jahren.
Ganz typisch sind also Drohbotschaften für jene, die nicht spuren, die Zweifel an der Echtheit äußern oder sich sogar dagegen aussprechen.

Fall-Beispiel SIEVERNICH
So erklärte die Erscheinungs-Maria von Siervernich am 4. Juni 2005, derjenige werde sich „vor ihrem Sohn verantworten müssen“, der in das Rohr zum Brunnen „etwas hineinwirft“. (Es ging um eine erfolgte Bohrung für ein angebliches „Heilungswasser“.)
Einen Tag später wiederholt das Phantom ihre Drohung: „Mein Kind, bete und tue alles, was ich Dir sage. Wer auf mein Wort nicht hört, wird dies vor meinem Sohn verantworten müssen.“
Bereits zwei Jahre zuvor, am 14. Juli 2003, wurden jene Geistlichen, die nicht an die Visionen von Manuela Strack glauben, ebenfalls in ein schiefes Licht gerückt:
„Viele Priester glauben nicht an mein Kommen und verleugnen meinen Sohn. Sie sind gegen dich, weil sie auch wider meinen Sohn sind. Sie verwunden täglich mein Herz.“
Am 1. März 2004 sandte die angebliche Gottesmutter folgende Kundgabe an Manuelas Verehrerschar: „So wird alles, was sich euch entgegenstellt, wie ein Windhauch vergehen.“
Da kann es manchem Erscheinungsbewegten warm ums Herz werden!
Fall-Beispiel RÄDLER in WIGRATZBAD
Das bischöfliche Ordinariat Augsburg wirft dem Buch „Sieg der Sühne“ von Alfons Sarrach vor, daß es Kritikern der Wigratzbader Privatoffenbarungen von Antonie Rädler mit Unheil und Tod drohe.
Tatsächlich äußert sich der Verfasser – ein allseits bekannter Propagandist von Medjugorje – teilweise eher makaber – vor allem ab Seite 107:

Dort wird ausführlich geschildert, wie es dem Bürgermeister von Hergatz ergangen sei (der als Widersacher der „Seherin“ Rädler vorgestellt wird): Dieser NS-hörige Bürgermeister sei – politisch bedingt – durch Befehl eines SS-Kommandanten aufgehängt und dann „verscharrt“ worden.
Danach heißt es auf S. 108 weiter:
„Übrigens haben die größten Feinde Antonies einen tragischen Tod gefunden. Zu ihnen gehörte auch der Kreisleiter der Partei aus Lindenberg. Er wurde von befreiten Polen aus dem Auto geholt, zu Tode getrampelt und unter die Erde gebracht.“
Auf S.67 wird von einer Marienvision berichtet, die eine Bekannte von Antonie Rädler erlebt haben will. Dabei soll die „Erscheinung“ gesagt haben: „Ich kann die zerschmettern, die gegen diese Sache sind.“ (Gemeint ist der Kapellenbau in Wigratz.)
Ähnlich heißt es auf S. 89 aus dem Munde der „Seherin“ Antonie selbst: „Maria kann alle zerschmettern, die ihr widerstehen.“ – Ob das Geist und Ausdrucksweise der wirklichen Gottesmutter ist? – Gewiß nicht, denn die Mutter des HERRN ist keine „Rache-Madonna“.
Derartige Ausführungen erwecken den Eindruck einer irrgeistigen „Frömmigkeit“, die sich mit dem christlichem Glauben und einer bodenständigen, biblisch orientieren Marienverehrung nicht vereinbaren läßt.
Dabei kann die Ablehnung von Erscheinungen ohnehin kein Anlaß für eine „Strafe Gottes“ sein, zumal Privatoffenbarungen für die Gläubigen grundsätzlich nicht verbindlich sind – noch viel weniger, wo es sich in all dieen Fällen nicht einmal um kirchlich anerkannte Botschaften handelt.
Fall-Beispiel HIGGINSON:
Einige Hinweise aus der „Haupt-Christi“-Verehrung der englischen Visionärin Teresa Higginson (die auch in traditionalistischen Kreisen verbreitet ist):

Zum Zuckerbrot der Heilsgewißheit für Fans ihrer Haupt-Christi-Spezialandacht gehört auch die Peitsche der Verwünschungen für „Übeltäter“, die diese offenbar heilsnotwendige Sonderverehrung nicht pflegen oder sie gar „behindern“, was wie eine Freveltat bewertet wird.
Derart blutrünstige Bannflüche gegen Skeptiker wie hier liest man freilich recht selten in irrgeistigen „Botschaften“.
Hier folgen ein paar handfeste Drohungen gegen Kritiker:
„Was jene anbelangt, die durch Wort oder Werk versuchen, diese Andacht zu verhindern oder zu verwerfen, werden sie wie zu Boden geworfenes Glas sein oder wie ein gegen eine Mauer geschleudertes Ei, d.h. sie werden in Stücke geschlagen und vernichtet; sie werden verdorren und verwelken wie das Gras auf den Dächern.“
„Andererseits läßt Er mich erschaudern vor Schrecken angesichts der furchtbaren Strafgerichte, die das Los jener sein werden, die den Fortschritt dieser himmlischen Andacht hindern oder zu verhindern suchen werden… Sie werden gebrochen und vernichtet werden.“
Sodann folgt ein „Gebet“, das der „Herr“ seiner „Leidensbraut“ Higginson offenbart haben soll: „O Heiligstes Haupt, möge Deine Weisheit uns immer lenken… Mögen wir niemals die Verwünschungen vernehmen, die gegen jene ausgesprochen wurden, welche diese Andacht behindern oder verachten werden.“ –
Sogar im Gebet hat der „Andächtige“ also die Angst im Nacken. Soll so etwa die freiwillige Gottesliebe geweckt werden? Stattdessen ein System von Fluch und Angst, wie man es sonst nur aus dem finstersten Heidentum kennt.








 Total views : 8754023
Total views : 8754023

11 Antworten
Wallfahrtsorte und Wissenschaft und wundertätiges Wasser
https://kath-zdw.ch/maria/wallfahrtsorte.wundertaetiges.wasser.html
https://kath-zdw.ch/
.
Erwähnenswert wäre auch noch das „Handbuch der Parapsychologie“ katholischen Priesters Armando Pavese.
Es gibt auch scheinbare Bessenheitszustände, die aber in Wirklichkeit aus dem Unterbewusstsein kommen, und paranormale PSI-Phänomene, die aber in Wirklichkeit ihren Ursprung in den tiefen der Seele bzw. griechisch „Psyche“ des Menschen haben. Auch der Heilige und Kirchenlehrer Augustinus kannte schon das Unterbewusstsein, siehe auch den Templer und Arzt Arnaldus de Villanova der auch ein Buch über die Deutung von Traumsymbolen schrieb. Siehe auch den Psychologen C.G. Jung und der christliche Psychologin Christa Meves
Kardinal Müller befürchtet deutsches Schisma – das schon da ist
https://gloria.tv/post/PEtNqmH2KDvV414TAZGc2Mw8V
Wenn Menschen unter den Einfluss von Sekten geraten
http://irrglaube-und-wahrheit.de/index.php?/topic/1563-wenn-menschen-zu-monstern-werden-ein-erfahrungsbericht/
Es ist erschreckend, wie das frühere Nischen Phänomen Privatoffenbarung seit ca 20 Jahren in extrem traditionell praktizierende Kirchen Kreisen dominiert
Guten Tag,
da haben Sie recht, das Phänomen hat seit Mitte der 90er Jahre deutlich zugenommen, nicht zuletzt durch Medjugorje mitverursacht. Es sind aber insgesamt gesehen weniger die traditionellen Kreise (alte Messe-Anhänger), sondern die „Neo-Konservativen“ – siehe das erscheinungsbewegte und charismatische Kath.net als Beispiel. Auch die Charismatik zieht eher die Allgemein-Konservativen an, weniger die Traditionalisten.
In Medjugorje wird allein die neue Messe gefeiert – und das nicht einmal sonderlich konservativ.
Was in Traditionalisten-Kreisen eher noch verbreitet ist: Heroldsbach, Garabandal, Amsterdam, Rosa Mystica (Montichiari), also die „alten“ Erscheinungsphänomene. – Medjugorje wird weitgehend abgelehnt.
Freundlichen Gruß
Felizitas Küble
Rezension: Der drohende Tod biblischer Seelsorge – geistliche Begleitung in der Fortschrittsfalle?
https://www.thecathwalk.de/2021/02/18/rezension-der-drohende-tod-biblischer-seelsorge-geistliche-begleitung-in-der-fortschrittsfalle/
https://www.thecathwalk.de/
Siehe zur Falschmystik auch de „Zeugen der Wahrheit“ (ZDW) Website. Philo(n) von Alexandrien, von dem auch der Apostel Paulus im Neuen Testament der Bibel zitiert, siehe auch Elias Erdmanns Aufsatz zu ihm, gilt auch als einer der Vorläufer der Neuplatoniker.
Die Madonna von Medjugorje hat dem Bischof von Mostar einst gedroht „daß mein Gericht und das meines Sohnes“ (!) über ihn kommen werde- wenn er nicht den Angaben der Seherkinder glauben würde.
Das „Jesuskind“ persönlich hat in Heroldsbach einst dem ungläubigen Bamberger Domkapitel gedroht. Die Seherkinder und ihr Umfeld waren durch das bischöfliche Ordinariat unter Druck geraten. Dadurch äußerten sich die „himmlischen Erscheinungen“ in Heroldsbach immer aggressiver. Dies hatte gut zwei dutzend Exkommunkationen zur Folge: Die Seherkinder und ihr Umfeld waren davon betroffen.
Die Exkommunikationen wurden erst in den Neunziger Jahren zurückgenommen, nachdem die angeblichen Seherinnen vor einer bischöflichen Kommission zugesagt hatten, nicht mehr über die Erscheinunge zu sprechen (ihre Andenkläden und Übernachtungsmöglichkeiten führten die Seherinnen aber natürlich weiter).
Das hat vor über zwanzig Jahren den Bischof Braun nicht gehindert, Heroldsbach als „Gebetsstätte“ anzuerkennen.
Alles altbekannte Versatzstücke der Falschmystik.
Mindestens ebenso schwer wiegend ist die liturgische Katastrophe der Abschaffung der alten tridentinischen Messe als „Heiliger Messe aller Zeiten“ und und die Abschaffung des kleinen Laienexorzismus und der Priester-Mangel durch unbiblisches Festhalten am Pflicht-Zölibat für Priester – die Kirche macht es sich hier meiner Ansicht nach unnötig schwer, auch gibt es im Neuen Testament der Bibel eine Diakonin namens Phoebe usw.
Es gibt keine Diakonin, keine Priesterin und keine Bischöfin. Das Sakrament der Weihe gliedert sich in drei Stufen und ist allein dem Mann vorbehalten.